Kinder - rechtliche Verpflichtung ohne wenn und aber
Kaum ein Ereignis ändert das Leben von Menschen so eindeutig wie die Geburt eines Kindes. Rechtlich gesehen erwartet die glücklichen Eltern ein ganz neuer Pflichten- und Regelkreis rund um das Kind. Die faktische Verantwortung für Wohl und Wehe des Kindes wird von einem ganzen Katalog rechtlicher Regelungen flankiert. Kinder haben eine Reihe von rechtlichen Ansprüchen gegenüber ihren Eltern, unabhängig davon, ob alle Beteiligten als Familie zusammenleben oder nicht.
Kinder sind faktisch und rechtlich sehr schutzbedürftige Rechtssubjekte. Im Mittelpunkt vieler rechtlicher Auseinandersetzungen stehen Fragen der elterlichen Sorge und des Umgangsrechts, zwischen Kindern und einzelnen Elternteilen geht es häufig um den Unterhalt. Aber es können auch andere tatsächliche Ereignisse im Leben der Kindern eine Rolle spielen, die einer rechtlichen Gestaltung bedürfen: Kinder können adoptiert werden, sie können einen Vormund benötigen oder eine Pflegschaft.
Möglicherweise muss ihnen das Jugendamt beistehen, weil die Eltern ihre Pflichten vernachlässigen. Im Wesentlichen ist das Kindschaftsrecht als Teil des Familienrechts im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) normiert. Das Sozialgesetzbuch VIII regelt Eingriffsbefugnisse des Staates bei Gefährdung des Kindeswohls.
Das Kindschaftsrecht im Überblick
Das Kindschaftsrecht als Teil des BGB hat folgende Schwerpunkte: - §§ 1591 bis 1600e BGB regeln Fragen der Abstammung - §§ 1601 bis 1615o BGB normieren die Unterhaltspflicht und den Kindesunterhalt - §§ 1616 bis 1625 BGB erfassen den allgemeinen rechtlichen Rahmen zwischen Eltern und Kind - §§ 1626 bis 1698b BGB strukturieren die elterliche Sorge - §§ 1741 bis 1772 BGB beschäftigen sich mit der Adoption - §§ 1773 bis 1895 BGB ordnen die Vormundschaft - §§ 1909 bis 1921 BGB definieren die Pflegschaft
Kinderrechte
Kinder haben neben den Versorgungs- und Unterhaltsansprüchen gegen ihre Eltern weitere Rechte allgemeiner Art. Die Charta der Grundrechte in der Europäischen Union regelt Kinderrechte in Art. 24. Kinder haben Anspruch auf Schutz und Fürsorge, dürfen ihre Meinung frei äußern, und haben weiterhin das Recht auf den regelmäßigen Umgang mit beiden Elternteilen. Letzterer Aspekt findet seinen Widerhall im deutschen Kindschaftsrecht, die gemeinsame elterliche Sorge ist der Regelfall. Art. 24 stellt das Kindeswohl in den Mittelpunkt entsprechender Entscheidungen von Behörden und Eltern - ähnlich dem deutschen Familienrecht. Nationale Normen zum Kindeswohl werden flankiert von der Kinderrechtskonvention der UN, die von fast allen Staaten dieser Welt ratifiziert wurde.
Kinder und das Wächteramt des Staates
Nach Art. 6 Abs. 2 Grundgesetz haben primär die Eltern die Verantwortung für das Kindeswohl, die ihren Ausdruck in der elterlichen Sorge findet. Vernachlässigen Eltern ihre Fürsorgepflichten, wächst dem Staat in Gestalt der zuständigen Behörde (Jugendamt) zusammen mit den Familiengerichten eine Wächterfunktion zu. Besteht der Verdacht auf eine Gefährdung des Kindeswohls, haben die Behörden entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Dieser Bereich ist rechtlich und tatsächlich heikel. Spektakuläre Vernachlässigungsfälle sorgen in der Öffentlichkeit häufig für Diskussionen zum Thema Kindeswohl. Das Jugendamt wird dabei gern von allen Seiten als zu zögerlich kritisiert.
Kinder - schwierige rechtliche Fragen verlangen nach einem Familienrechtsexperten
Ob es um Unterhalt, Umgang oder die Auseinandersetzung mit dem Jugendamt geht, häufig wird professioneller Rat benötigt. Auf www.advogarant.de finden Sie Ihren Familienrechtsanwalt.
Aktuelle Fachbeiträge & Urteile
-
Beurteilungsmaßstab für die Bestimmung nachträglicher Herstellungskosten bei einem Gebäude ist die von der Baumaßnahme betroffene (Teil)Fläche, sofern diese die Eignung als Wirtschaftsgut besitzt.
-
Besteuerung einer befristeten Berufsunfähigkeitsrente bei einer kombinierten Renten- und Berufsunfähigkeitsversicherung
-
Beiträge, die Mitglieder eines Fitnessstudios trotz coronabedingter Schließung zahlen, unterliegen der Umsatzsteuer, wenn sich zu Beginn der Schließzeit auf eine beitragsfreie Vertragsverlängerung um die Zeit der Schließung geeinigt wurde.
-
Inanspruchnahme des Erbfallkostenpauschbetrages durch eine Vermächtnisnehmerin
-
Das Investmentsteuergesetz ermöglicht steuerliche Privilegierungen für luxemburgische Spezialfonds in der bis zum 31.12.2017 geltenden Fassung auch dann, wenn der Anleger maßgeblich oder alleine faktisch Einfluss auf die Verwaltung dessen nimmt.
-
Das Finanzamt darf die bei Veranlagung in zu geringer Höhe als Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung angesetzten Vorsteuererstattungsbeträge nach formeller Bestandskraft des Einkommensteuerbescheids unter Umständen nicht korrigieren.
-
Abzugsfähigkeit von Stellplatzkosten im Rahmen einer beruflich veranlassten doppelten Haushaltsführung
-
Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer einer vercharterten Motoryacht
-
Allgemeine Aufwendungen für den Privatschulbesuch eines hochbegabten Kindes stellen keine außergewöhnlichen Belastungen dar, weil es sich nicht um unmittelbare Krankheitskosten handelt.
-
Ein Beteiligter darf erst dann davon ausgehen, dass er ein bestimmtes Dokument erfolgreich an das Gericht übermittelt hat, wenn er für das übermittelte Dokument vom Gericht eine Bestätigung erhalten hat.
Sofort-Beratersuche
Diese Funktion nutzt Google Dienste, um Entfernungen zu berechnen.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
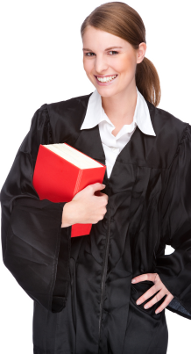
Sie wollen erfolgreich Kunden gewinnen und binden?
Wir helfen Ihnen als starker Partner für Marketing & Organisation
AdvoGarant Artikelsuche








